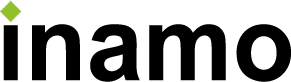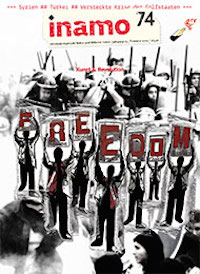
Gastkommentar
Asghar Schirazi: Irans überraschende Präsidentenwahl
Kunst und Revolution
Kultur und Revolution in Ägypten
Von Viola Shafik
Revolution schreiben: Mona Prince und der Tahrir
Von Samia Mehrez
Das Buch „Ismi Thawra (Revolution ist mein Name) von Mona Prince ist ein kreatives nicht-fiktionales Werk, das für den Aufstand in Ägypten im Januar 2011 steht und wie kein anderer aktueller literarischer Text von dessen Unschuld und Naivität geprägt ist. Deswegen ist es zugleich Zeugnis und Schöpfung der Revolution und gilt unter renommierten nationalen und internationalen Literaturkritikern als der Text, der am besten den Tahrir-Geist verkörpert – mithilfe von Erzähltechniken, Sprachregistern und literarischer Ästhetik, die ein fester Bestandteil der Tahrir Erfahrung sind.
Mein Name ist Revolution
Von Mona Prince
Gegen alle Widerstände: Das El Hamra-Theater in Tunis
Von Katharina Pfannkuch
Seit über zwei Jahrzehnten begeistert das EL Hamra-Theater mitten in Tunis sein Publikum. Mit Leidenschaft und politischem Mut kämpft das Theater für ein freies Tunesien.
Politisches Theater in Syrien – Das Zimmertheater
Von Abdellatif Aghsain
Das im Folgenden beschriebene Projekt der Malas-Zwillinge wird von dem syrischen Lyriker und Schriftsteller Omar Khaddur zur „marginalen Sparte des politischen Theaters“ gerechnet. Die Sketche und Stücke der Malas-Brüder sind eine Sonderform des politischen Theaters und schwanken zwischen politischem Kabarett und reiner Comedy Unterhaltung.
Zeichnerinnen aus Algerien: Rym Mokhtari, Nawel Louerrad
Von Anna Gabai
Das Kollektiv Zan Studio, Sharek Youth Forum und Nidal El Khiary
Von Anna Gabai
Graffiti in Ägypten und Syrien: Wenn Wände schreien
Von Mona Sarkis
Der politische Kampf mit visuellen Mitteln im Jemen
Von Marie-Christine Heinze
Der visuelle Machtkampf im Jemen ist in vielerlei Hinsicht ein Kampf um den politischen Diskurs in den zentralen Städten des Landes. Während außerhalb der Hauptstadt Sanaa der Stellungskrieg der zentralen Akteure mit militärischen Mitteln ausgetragen wird und eine ausgewählte Gruppe von 565 Delegierten im Mövenpick Hotel in Sanaa die Zukunft des Landes diskutiert, geht es auf den Mauern der Stadt um die Vorherrschaft im öffentlichen Raum. Die im aktuellen Transitionsprozess marginalisierte Jugend stellt sich dabei dem Machtkampf der Eliten mit der Kampagne „Die Mauern erinnern sich an ihre Gesichter“ entgegen und erinnert hiermit an die Verbrechen der rezenten Vergangenheit.
Widerstandsformen in Marokko – Rap und Straßentheater
Von Hafid Zghouli
Inspiriert durch die arabischen Revolutionen, provozierte die Protestbewegung „Mouvement 20 fevrier“ oder kurz „20. Februar“ nicht nur eine von der politischen Elite lang ersehnte aber nie ausdrücklich geforderte Verfassungsreform. Möglich machte sie es auch, die Tatsachen beim Namen zu nennen, die das politische System in Marokko von innen auffressen und für die vielschichtige Misere der marokkanischen Bevölkerung verantwortlich sind: Absolutismus und Korruption.
Rap in Tunesien: Revolution oder Evolution?
Von Eva Kimminich
Die Stimme der Frauen – Sawt Nissa
Rap von Soultana
Tanzender Widerstand in Tunesien
Katharina Pfannkuch
Zwei Jahre nach der Revolution herrscht ein Klima der Anspannung in Tunesien. Zunehmende Gewalt und der wachsende Einfluss der Islamsiten verunsichern die Menschen. Die Gruppe „Danseurs Citoyens“ leistet Widerstand – auf ihre ganz eigene Art.
Syrische Künstler im Widerstand „gefälschte Realität“
Von Inana Othman
Syrien: Widerstand mit Puppentheater und Plakaten
Von Christin Lüttich
Kunst als Waffe – Fremd- und Selbstbestimmung
Von Irit Neidhardt
Bei den meisten Demonstrationen und Protestcamps weltweit werden Plakate, Spruchbänder, Protestlieder, Graffitis und andere Formen der Straßenkunst medienwirksam eingesetzt. So auch in Tunesien, Ägypten und Syrien. Vor dem Eindruck der Diktatur wurde dies in Europa bereits als Kunst betrachtet. Handyfotos, Videomitschnitte von Demonstrationen, von Polizeigewalt und von Sit-ins sowie Berichte im Internet galten als Bürgerjournalismus und Zeichen einer neuen Freiheit. Auch wenn es all dies bereits Jahre zuvor gegeben hat. In ihrem Artikel setzt sich Irit Neidhardt kritisch mit der Beziehung zwischen Kunst und Protest auseinander.
Nachruf
Erinnerungen an „Le Journal“
Von Jörg Tiedjen
Es war bloßer Zufall, aber im Rückblick erscheint es als Programm: Als am 17. November 1997 zum ersten Mal die Wochenzeitung „Le journal“ erschien, da war das Titelthema natürlich die Ernennung des Sozialisten Abderrahmane Youssoufi an die Spitze der marokkanischen Regierung, mit der Hassan II wenige Tage zuvor die sogenannte „Alternance“ eingeleitet hatte, wie der erhoffte Übergang des Königreichs zur Demokratie damals genannt wurde. Während die Sozialisten scheiterten und auch ihren heutigen Nachfolgern, den Fundamentalisten, ein ähnliches Schicksal droht, hielt „Le journal“ unverdrossen an den Idealen von damals fest, bis sie Anfang 2010 geschlossen wurde, unter dem Vorwand, Schulden einzutreiben. Umgekehrt kann Verdienst der Zeitschrift gar nicht hoch genug geschätzt werden, als unverzichtbare Chronik und Analyse jener Jahre und als Vorkämpferin der Meinungsfreiheit.
Syrien
The Syrian Heartbreak
Von Peter Harling und Sarah Birke
Die Autoren untersuchen den Konflikt und die verschiedenen Kräfte, die daran beteiligt sind. Sie legen dar, wie das Regime mit seiner extremen Vorgehensweise und Gewalt die Militarisierung und Radikalisierung, vorangetrieben hat und dass es der Opposition nicht gelungen ist, sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Die Vorstöße der Opposition hätten die Gewalt des Regimes gesteigert, „während die Opposition schonungsloser geworden ist“. Die „Verbündeten“ und „Freunde“ der verschiedenen Lager – die USA, Russland, Qatar, der Iran, Saudi-Arabien, der Irak, die Türkei und die Hizbullah – würden alle nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Auch die „islamistischen Netzwerke, die syrischen Geschäftemacher und die Kriegsbeute würden wesentlich zum Gewaltaufkommen beitragen.“ Nach Ansicht der Autoren ist mit „wachsender, unentschlossener Einmischung von allen Seiten eine weitere Eskalation beinahe unvermeidlich.“
Die syrische Katastrophe
Von Omar S. Dahi
Aus offensichtlichen Gründen wird die Berichterstattung über den Aufstand und den Bürgerkrieg in Syrien von der schrecklichen menschlichen Verlusten dominiert. Geschätzte 60.000 Syrer (oder mehr) sind getötet worden, und Zehntausende mehr sind physisch und psychisch von der Gewalt gezeichnet. Bis Ende Februar waren über 3 Millionen Syrer entweder Binnenflüchtlinge oder Flüchtlinge in angrenzenden Ländern.
„Die Koalition bietet ein verächtliches Schauspiel“
Interview mit Yassin al-Hajj Salih
Yassin Al Haj Saleh ist Journalist und Autor, von 1980 bis 1996 war er politischer Gefangener, und zur Zeit lebt er in Damaskus im Untergrund. Er sagt zwar bescheiden, dass ihn niemand kennt, aber er ist eine wichtige kritische Stimme der Opposition. Schon früh hat er vor der Militarisierung des Konflikts gewarnt und Anfang 2012 vor der Gefahr jihadistischer Militanz: „Vielleicht wird die FSA…zu dschihadistischen Gruppen mutieren, die in ihrer Gesamtheit gewissermaßen ein syrisches Äquivalent zur Organisation al-Kaida darstellen, eine Organisation, die eine religiöse und keine nationale Sache vertritt und deren Instrumente nihilistische Gewalt und Terror sind, nicht die geregelte Verteidigung der Bevölkerung.“ Für Saleh war immer klar, dass die Kämpfer der FSA „administrativ, politisch, ideologisch, materiell und moralisch“ unter Kontrolle gehalten werden müssen (Zitate aus: Larissa Bender (Hg.) „Syrien. Der schwierige Weg in die Freiheit“). Leider wurde das Thema der Islamisierung des Konflikts sowohl von Saleh als auch von den Interviewern ausgeklammert.
Migration
Lagerware Mensch – UNHCR und EU-Migrationsregime
Von Marvin Luedemann
Die EU-Migrationspolitik baut keine Mauern, sie knüpft ein engmaschiges Netz aus Kontrolle und Verwaltung von Migrationsbewegungen, das weit über den Schengenraum hinaus reicht. So werden Diktaturen zu Kooperationspartnern in der Migrationsabwehr und bisherige Herkunftsländer von Asylsuchenden zu so genannten sicheren Drittstaaten in die selbst Transitmigranten zurück geschoben werden können. Einzige Voraussetzung: ein eigenes Asylsystem. Um die Herstellung eines solchen kümmert sich gerne der UNHCR (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen), der auch ansonsten ein willkommener Partner der EU in der Verwaltung von Migration ist. Dies versucht dieser Beitrag anhand des Flüchtlingslagers Choucha in Tunesien zu zeigen.
Türkei
Der Gezi-Aufstand: „Verflucht seien…manche Dinge!“
Von Corinna Eleonore Trogisch
Ende Mai hat sich ausgehend vom zentralen Gezi-Park in Istanbul binnen weniger Tage eine Protestbewegung über das ganze Land bis in die Kleinstädte ausgebreitet. Anlass war eines der typischen Kahlschlag-Sanierungvorhaben der letzten Jahre: Der Gezi-Park soll einem renditeträchtigen Bauvorhaben weichen, das vermeintlich eine historische Struktur, die 1940 abgerissene Topçu-Kaserne, aufleben lässt. In deren Innerem: ein weiteres Einkaufszentrum. Die Gesamtplanung für den Bereich des Taksim-Platzes lässt kritischen Stadtplanern zufolge erkennen, dass dessen Funktion als Versammlungsort beendet werden soll – was vorsorglich schon einmal am Ersten Mai mit einem immensen Polizeiaufgebot und der Sperrung des größten Teils öffentlicher Verkehrsmittel durchgesetzt wurde, schon dies eine bedrückende Machtdemonstration des Staates gegenüber der gesellschaftlichen Opposition.
Mali
Friedenspreis für Krieg in Mali
Von Jörg Tiedjen
Letzten Herbst hatte François Hollande noch die alte französische Politik der Einmischung in die inneren Angelegenheit afrikanischer Staaten für beendet erklärt, womit er auch Françafrique meinte, jenes Geflecht aus Wirtschaft und Politik, das Konzernen die Profite, Politikern ein Taschengeld und den Statthaltern in Afrika im Gegenzug die Macht sichert. Entsprechend zeigte sich Hollande neutral, als im Dezember in der Zentralafrikanischen Republik Rebellen auf die Hauptstadt Bangui vorrückten und Präsident Bozizé in die Flucht schlugen – lediglich zum Schutz der eigenen Staatsbürger und Interessen entsandte man eine kleine Eingreiftruppe. Wie aber ist vor diesem Hintergrund die Militärintervention in Mali zu deuten? Sie soll weder Einmischung noch Interessenwahrung sein, sondern wird als uneigennützige Rettungsaktion dargestellt, für die Hollande am 5. Juni sogar mit dem Friedenspreis der UNESCO ausgezeichnet wurde.
Sudan/Südsudan
Der Einbruch nach dem Durchbruch
Von Roman Deckert und Tobias Simon
Die kürzliche Einigung zwischen Sudan und Südsudan scheint schon wieder hinfällig.
Ökonomiekommentar
Die versteckte Krise der Golf-Staaten
Von Hugo Micheron
Zeitensprung
Der Unbeugsame: George Ibrahim Abdallah
Von Jörg Tiedjen
George Ibrahim Abdallah ist neben den US-amerikanischen Bürgerrechtlern Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal sowie dem Palästinenser Karim Younes einer der am längsten inhaftierten politischen Gefangenen. Seit 1984 wird er in Frankreich gefangen gehalten, seit 1999 könnte er ohne Weiteres freigelassen werden. Ihm wird vorgeworfen, als Führer einer revolutionären libanesischen Untergrundgruppe unter anderem für die Ermordung des US-Militärattachés Charles Ray und des israelischen Diplomaten Yacov Barsimantov Anfang der Achtziger Jahre in Paris verantwortlich gewesen zu sein. Dass die Attentate vor dem Hintergrund eines Krieges stattfanden, an dem alle betroffenen Seiten beteiligt waren und der vor Staatsgrenzen keinen Halt machte, wird ausgeblendet. Abdallah weigert sich, den Widerstand zu bereuen, und die USA sind fest entschlossen, ein Exempel im Kampf gegen den Terror zu statuieren. Keinesfalls wollen sie zulassen, dass er als Held in seine Heimat zurückkehrt.
Ex Mediis
William Blum: Zerstörung der Hoffnung, bewaffnete Interventionen der USA und des CIA seit dem 2. Weltkrieg
Von Matin Baraki
Janna Graf: weibliche Genitalverstümmelung aus Sicht der Medizinethik. Hintergründe – ärztliche Erfahrung – Praxis in Deutschland
Von Nils Fischer
Nachrichten//Ticker